|
Devisenknappheit
In der DDR produzierte Waren wurden u.a. auch ins kapitalistische Ausland verkauft. Die dabei eingenommenen Devisen*
(Fremdwährung) wurden u.a. für den Einkauf von Gütern benötigt, die in der DDR oder anderen sozialistischen Ländern nicht produziert bzw. erhältlich waren. Dazu zählte Kaffee. 1977 stiegen die Weltmarktpreise für
Kaffee. Zahlte die DDR noch in den Jahren 1972-75 pro Jahr 150 Millionen Valutamark, lag der Preis für 53307 Tonnen Kaffee im Jahr 1976 über 667,2 Millionen Mark.
Damit war es der DDR unmöglich geworden, die Bevölkerung ausreichend mit Kaffee zu versorgen. Außenhandelsspezialist Alexander Schalck-Golodkowski empfahl, die Herstellung sämtlicher
Kaffeeprodukte einzustellen. Lediglich die teuere Marke “Rondo” mit einem Kilopreis von 120 Mark, “Mona” und “Mokka-Fix Gold” sowie eine Billigmarke mit einem 50prozentigen Anteil
an Surrogaten sollten weiter vertrieben werden. Die Billigsorte hatte allerdings ein schlechtes Aroma und beschädigte zudem zahlreiche Kaffeemaschinen. Schnell erhielt die Kaffeesorte deshalb den Beinamen
“Erichs Krönung”, abgeleitet von der westdeutschen Kaffeemarke “Krönung” und mit Bezug auf Erich Honecker.
Im Jahr 1978 schließlich entspannte sich die Kaffeekrise.
Doch in der 2. Hälfte der 1970er Jahren war nicht nur die Einfuhr von Kaffee schwierig geworden. Auch Werkstoffe wie Holz, Baumwolle, Leder, Häute oder Spanplatten konnten nicht in
ausreichendem Umfang importiert werden.2
Um den Devisenmangel zu beheben, wurden deshalb verstärkt einheimische Erzeugnisse wie Porzellan, Spiegelreflexkameras oder Waschmaschinen exportiert. Dadurch verschlechterte sich die
Situation für die DDR-Bürger zusätzlich, da eben diese Produkte auf dem inländischen Markt nur noch schwer zu bekommen waren.
Großstadtorientierte Warenverteilung
Die Belieferung mit Waren konzentrierte sich auf repräsentative und bevölkerungsreiche Zentren. In Berlin war die Versorgungslage stets besser als in den übrigen Gebieten der DDR. Die
Hauptstadt wurde besser beliefert, um gegenüber ausländischen Touristen den Schein einer florierenden Wirtschaft zu erwecken. Dies verleitete viele Bürger aus der Provinz zu der feindlichen Äußerung “Ihr habt
ja alles!”
Nach Berlin wurden das nahe Umland, z.B. Potsdam und Frankfurt/ Oder sowie die übrigen Bezirkshauptstädte versorgt, allen voran die Messestadt Leipzig und die Grenzstädte Rostock, Schwerin, Magdeburg, Erfurt und Suhl.
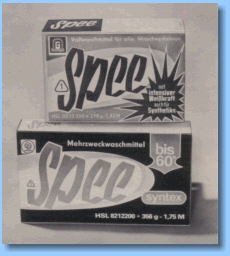
In den Kleinstädten oder auf dem Dorf war die Belieferung mit Waren wesentlich schlechter, so daß viele Bürger zum Großeinkauf in die größeren Städte fuhren:
“Am Sonnabend stieg man ins Auto oder in die Eisenbahn, stellte sich in die Schlangen und
kehrte schwer bepackt zurück. … Bekannte und Verwandte, die in der Hauptstadt oder in den Bezirksstädten arbeiteten oder studierten, erhielten den Auftrag, am Wochenende
Papierwindeln, Honig, Waschmittel der Marke “Spee” und vieles andere mehr mitzubringen.”3
Der Einkauf war meist zeitraubend und stressig. Er war geprägt vom Durchsuchen mehrerer
Geschäfte nach einem Produkt. Zahlreiche Nahrungsmittel, z.B. Brot, Butter oder Fleisch, waren meist ab 16 Uhr nicht mehr vorrätig, die Regale leer. Deshalb nutzte man jede freie
Minute, selbst die Mittagspause, zum Einkaufen. Manchmal wurden Produkte angeboten, die im allgemeinen nicht erhältlich waren. Dann reihte man sich in die Schlange der Kunden ein
und hoffte, nicht vergebens gewartet zu haben. Mangelware konnte zeitweise fast jedes Produkt sein, aber ganz besonders selten waren z.B. Jeanshosen, Elektrogeräte oder Südfrüchte wie Bananen oder Apfelsinen.
Die einzige Möglichkeit, gezielt und ohne langes Suchen z.B. ein gutes Stück Fleisch einzukaufen, bestand darin, sich die Verkäuferin
gewogen zu machen und sich etwas zurücklegen zu lassen. Nur so konnte man die Mahlzeiten voraus planen und dem Besuch am Wochenende ein gutes Essen servieren.
Fußnoten:
1Wolle, Stefan, Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Herrschaft in der DDR 1971-1989, Bonn 1998, S. 199f.
2ebd.
3ebd., S. 201.
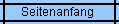
|

